| Ohel Jacob Synagoge
1918 wurde von Mitgliedern der Leipziger Israelitischen Religionsgemeinde der Verein Ohel Jacob gegründet. Nach seiner Gründung organisierte der Verein zunächst Gottesdienste in der Aula beziehungsweise Turnhalle der Höheren Israelitischen Schule sowie in der Kongresshalle. Die Vereinsmitglieder erwarben verschiedene religiöse Gegenstände und gaben Platzkarten für die Gottesdienste aus. Der Verein Ohel Jacob kaufte ein Gebäude in der Pfaffendorfer Str. 4 und richtete 1922 eine Synagoge gleichen Namens ein. Ohel Jacob bedeutet dabei so viel wie „Zelt Jakob“. Die Synagoge war nach der Großen Gemeindesynagoge und der Ez-Chaim-Synagoge die drittgrößte Synagoge in Leipzig. Sie fasste zwischen 300 und 400 Personen. Der Ritus der Synagoge war orthodox und man war besonders um rituelle Reinheit bemüht. Die Gottesdienste fanden täglich statt. Insgesamt ist über die Synagoge aber recht wenig bekannt, auch sind keine Fotos von ihr überliefert. Als Rabbiner für die Synagoge war der Rabbinats-Assessor (was ein Rabbiner ist, zu dessen Aufgabenbereich die Entscheidung religiöser Fragen gemäß dem Talmud und dem jüdischen Religionsgesetz gehört) Moses Rogosnitzky zuständig, der auch in dem Gebäude wohnte. Als Oberkantor und Vorbeter agierte bis 1927 Salomon Stern. Anschließend übernahm Salomon Kupfer die Arbeit in der Synagoge. Auf seine Anregung hin erfolgte 1928 die Gründung eines Synagogenknabenchors. Vorsitzender der Synagoge war Elkan Tänzer. Im Gebäude Pfaffendorfer Straße 4 befanden sich auch die Schule für hebräische Sprache und Literatur „Techijja“ zu Leipzig von Dr. Mojssch Woskin-Nahartabi sowie ein hebräischer Kindergarten und das Auktionshaus von Rudolf Kormes. Vermutlich wurde die Synagoge bereits vor der Pogromnacht im November 1938, aus bisher unbekannten Gründen, geschlossen. Für den Verein Ohel Jacob beantragte die die Istaelitische Religionsgemeinde im August 1939 die Löschung aus dem Vereinsregister. Das Gebäude in der Pfaffendorfer Str. 4 wurde durch einen Bombenangriff während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Literatur: Trautmann, Sven (2024): Synagogen und Betstuben in Leipzig, Hentrich & Hentrich. Kowalzik, Barbara (1996): Wir waren eure Nachbarn. Pro Leipzig. |
Ohel Jacob Synagoge
In 1918, members of Leipzig’s Jewish religious community founded the Ohel Jacob association. After its foundation, the association initially organised services in the auditorium or gymnasium of the Higher Israelite School and in the Congress Hall. The members of the association purchased various religious artefacts and issued tickets for the services. The Ohel Jacob association bought a building at Pfaffendorfer Str. 4 and set up a synagogue of the same name in 1922. Ohel Jacob means something like ‘Tent of Jacob’. The synagogue was the third largest synagogue in Leipzig after the Great Community Synagogue and the Ez Chaim Synagogue. It could hold between 300 and 400 people. The rite of the synagogue was orthodox and particular attention was paid to ritual purity. Services were held daily. Overall, however, very little is known about the synagogue and no photos of it have survived. The rabbi in charge of the synagogue was the rabbinical assessor (what a rabbi is, whose duties include deciding religious questions in accordance with the Talmud and Jewish religious law) Moses Rogosnitzky, who also lived in the building. Salomon Stern acted as head cantor and prayer leader until 1927. Salomon Kupfer then took over the work in the synagogue. At his suggestion, a synagogue boys‘ choir was founded in 1928. The chairman of the synagogue was Elkan Tänzer. The building at Pfaffendorfer Straße 4 was also home to Dr Mojssch Woskin-Nahartabi’s ‘Techijja’ school for Hebrew language and literature in Leipzig, as well as a Hebrew kindergarten and Rudolf Kormes‘ auction house. The synagogue was presumably closed before the pogrom night in November 1938, for reasons as yet unknown. In August 1939, the Istaelitische Religionsgemeinde applied for the Ohel Jacob association to be deleted from the register of associations. The building at Pfaffendorfer Str. 4 was destroyed in a bombing raid during the Second World War. Literature: Trautmann, Sven (2024): Synagogen und Betstuben in Leipzig, Hentrich & Hentrich. Kowalzik, Barbara (1996): Wir waren eure Nachbarn. Pro Leipzig. |
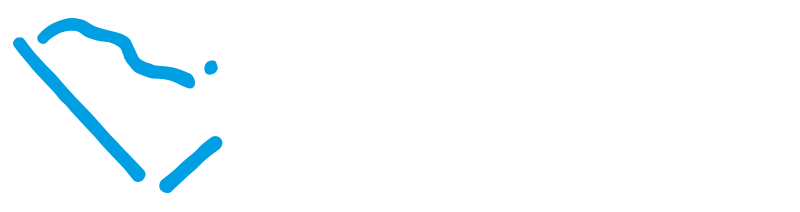
Seite auswählen










